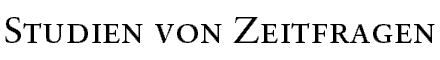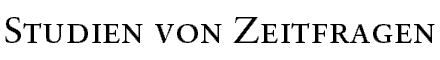Richard Löwenthal in Neue Gesellschaft:
Identität und Zukunft der SPD
Prof. Dr. Richard Löwenthal, Professor für Politische Wissenschafien
mit den Hauptinteressengebiet Außenpolitik, Jahrgang I908, ist stellvertretender Vorsitzender der Grundwertekommission beim Parteivorstand der SPD. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Theorie des demokratischen Sozialismus. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen wurde insbesondere das unter dem Autorennamen Paul Sering erschienene Werk »Jenseits des Kapitalismus« (Februar l947) politisch wichtig. Eine Neuauflage mit einer Ergänzung gibt es seit 1977 im J. B. W. Dietz Verlag.
Die Sozialdemokratie ist nicht nur die älteste deutsche Partei. Sie ist auch diejenige Partei, die durch ihre mehr als hundertjährige Tradition am tiefsten im Kampf um die Durchsetzung, Verteidigung und Weiterentwicklung einer freiheitlich demokratischen Ordnung verwurzelt ist. Es kann daher für keinen Demokraten ein gleichgültiger Vorgang sein, wenn diese Partei sich in einer ernsten Identitätskrise
befindet. Ich meine damit nicht einfach, daß die Sozialdemokratie seit einer Reihe von Monaten bei allen de-moskopischen Umfragen in einem stetigen Rückgang ist, den die Berliner Wahlen und die hessischen und niedersächsischen Kommunalwahlen bestätigt haben. Daß eine Partei, die seit etwa 12 Jahren die Bundesregierung führt, in einer Periode wirtschaftlicher Schwierigkeiten ungewöhnlichen Ausmaßes Rückschläge
erleidet, ist an und für sich ein normaler Vorgang, der nichts über ihre Zukunft aussagt. Das Ungewöhnliche und Bemerkenswerte ist vielmehr, daß die Abwanderung von Anhängern und Wählern gleichzeitig in zwei entgegengesetzten Richtungen vor sich geht: Auf der einen Seite zeigt sich ein deutlicher Verlust von Jungwählern, eine mangelnde Anziehung auf neue Jugendschichten und eine Abwanderung von primär ökologisch interessierten Gruppen zu
»grünen« und »alternativen« Listen oder zur Wahlenthaltung; auf der anderen Seite verliert die SPD einen Teil ihrer sogenannten »Stammwähler«, besonders – aber keineswegs ausschließlich – unter den Facharbeitern und in den Großstädten, nach deren Meinung die Partei sich zu sehr der unruhigen Jugend anpasse und zu wenig um die Verteidigung des Rechtsstaats und die Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit kümmere, und die deshalb zur CDU
abwandern oder ebenfalls bei der Wahl zu Hause bleiben. Beides zusammen ergibt eine Tendenz zum Zerfall des Bündnisses verschiedener Schichten mit zunächst vereinbaren, aber zu verschiedenen Prioritäten drängenden Interessen, durch das die SPD zur mehrheitsfähigen Volkspartei geworden ist – mithin eine Identitätskrise, die sich auch in verschärften innerparteilichen Auseinandersetzungen reflektiert.
Es ist ein Verdienst von Willy Brandt, daß er – nach langem Schweigen – in seiner Gedenkrede für Willi Eichler vom 21. Oktober (siehe in diesem Heft S. 1069 bis 1085; Red.) diese Frage nach der Identität der Sozialdemokratie und nach der weiteren Integrierbarkeit der Tendenzen, auf die sie sich im letzten Jahrzehnt gestützt hat, zum Thema gemacht hat. Er hat sich dabei vor allem gegen die »überspitzte Fragestellung« gewandt, »als ob wir Arbeiterwähler zugunsten von
Randgruppenwählern preisgeben wollten« – eine Fragestellung, die er vor allem der CDU und der ihr nahestehenden Presse zuschreibt, die aber in letzter Zeit auch innerhalb der SPD von deren »rechtem« Flügel laut geworden ist. Er hat darauf mit der unbestreitbaren Feststellung geantwortet, daß die Sozialdemokratie niemals eine »reine« Arbeiterpartei war und seit dem Godesberger Programm eben durch die wachsende Integrierung von Angehörigen der
»Büroberufe«, des Dienstleistungsgewerbes, des öffentlichen Bereichs mehrheitsfähig geworden ist; und mit dem Hinweis auf das – im großen und ganzen – erfolgreiche Vorbild der Öffnung der Partei für eine frühere Welle kritischer Jugend nach der Studentenrevolte der späten sechziger Jahre. Und er hat daraus die Schlußfolgerung gezogen, daß – wie damals, so heute – die Integrierung des Hauptteils der protestierenden Jugend – abgesehen von der Minderheit unbelehrbar
intoleranter und darum auch demokratiefeindlicher Gewaltanbeter – aufgrund einer Vereinbarkeit ihrer grundlegenden humanen Ziele mit denen der Sozialdemokratie notwendig und auf die Dauer auch möglich sei. Ich will meinen Eindruck nicht verhehlen, daß Willy Brandt sich in dieser wichtigen Rede die Antwort auf seine Frage, die ja in der Tat eine Schicksalsfrage der Sozialdemokratie ist, etwas zu
leicht gemacht hat: Ich glaube, daß der Vergleich mit der »Öffnung« der SPD zu Anfang der 70er Jahre in entscheidenden Punkten nicht stimmt, und daß der Gegensatz, der heute die abdriftenden Jugendlichen von der Masse der bisherigen Stammwähler der SPD trennt, härter ist, als er annimmt. Um mit dem historischen Vergleich zu beginnen: Zur Zeit der Studentenrevolte war die Sozialdemokratie mit ihrer Kritik am
»verkrusteten CDU-Staat« im Aufwind – auch unabhängig von dieser Revolte. Das Element von nachgeholter Aufklärung, von Erschütterung überlebter traditioneller Autoritüten, das eine der Grundlagen der Jugendrevolte war, hat gewiß auch zu diesem Aufwind der demokratischen Linken beigetragen. Aber in der Studentenrebellion gab es auch ein anderes Grundelement – ein Element von revolutionären Phantasmen und Illusionen, die zeitweise viele der jungen Menschen gegen
den demokratischen Staat mobilisierten – und die Öffnung der SPD für jene Jugendgeneration wurde erst in dem Maße möglich und fruchtbar, wie diese revolutionären Illusionen, denen die SPD stets entgegengetreten war, abklangen und die Bildung der sozialliberalen Koalition ihnen einen gangbaren Weg der Reform zeigte. Die Regierungsbildung von 1969 war nicht die Folge, sondern die Voraussetzung jener Öffnung; erst danach konnte die
Öffnung zu Brandts großem Wahlsieg von 1972 beitragen, und erst dann konnte die demokratische Integrierung jener, die zum »Marsch durch die Institutionen« ausgezogen waren, sich in den meisten Fällen erfolgreich vollziehen. (Ich sage: In den meisten Fällen. Denn es gibt bekanntlich einen Rest von unintegrierbaren Dogmatikern, der mit seinem »Stamokap« und anderen Formen des Neomarxismus die Organisation der Jungsozialisten seit Jahren zur Sterilität verurteilt und zu einer
Schranke zwischen der Sozialdemokratie und der heutigen, nichtmarxistischen Jugendgeneration gemacht hat.) Die heutige Jugendrebellion trifft nicht nur auf eine Sozialdemokratie, die im zwölften Jahr der Hauptverantwortung für die Bundesregierung und im Zeichen der schleichenden Wirtschaftskrise unvermeidlich an Anziehungs- und Integrationskraft verloren hat – ist sie auch
von völlig anderer Art als die Studentenrevolte von einst. Eine Ähnlichkeit gibt es nur zwischen den unintegrierbaren Randgruppen der vermummten Steinewerfer von heute und ihren damaligen Vorläufern. Aber die Masse der friedlichen, von humanen Motiven bewegten Protestler von heute wollen die Gesellschaft nicht revolutionieren: Sie wollen großenteils aus einer als hoffnungslos empfundenen Gesellschaft aussteigen und Inseln bilden, auf denen sie sich vor ihren Gefahren
schützen können. Das gilt nicht für den Hauptteil der breiten Friedensbewegung, in der die Aussteiger eine Minderheit (und die Krawallmacher eine noch viel kleinere Minderheit) sind. Aber es gilt für einen erheblichen Teil der grünen Welle – für jene selbstgetauften »Alternativen«, die eben eine Alternative neben der arbeitsteiligen Industriegesellschaft, an ihrem Rande, schaffen wollen.
Damit komme ich zu dem, was ich für den Kern des Problems halte: ein sehr sichtbarer Teil der heutigen Jugend – nicht die Jugend, aber doch ein nicht unwichtiger Teil – will unsere Gesellschaft nicht verändern, sondern sich aus der arbeitsteiligen Industriegesellschaft zurückziehen. Die Grundauffassung allzu vieler, die über die berechtigte Sorge um die Umwelt und den notwendigen Kampf gegen ihre Vergiftung hinaus eine »alternative« Ideologie vertreten, ist
der Glaube, daß alle moderne Technik des Teufels ist und die Schaffung der Industriegesellschaft ein historischer Irrweg war. Die praktische Grundhaltung allzu vieler, die aus verständlichem Widerwillen gegen die als sinntötend empfundene Arbeitszerlegung in vielen Industrien, vor allem am Fließband, und gegen den kommerziellen Konsumbetrieb heute aufs Land gehen, um biologische Nahrung zu züchten, morgen eine genossenschaftliche Kneipe aufmachen und
übermorgen ein Haus »instandbesetzen«, ist die Ablehnung der beruflichen Arbeitsteilung mit ihrer unter Umständen lebenslangen Spezialisierung. Nicht etwa, daß alle diese jungen Menschen »foul« wären – die bei weitem meisten arbeiten gern, etwa an der Hilfe für Mitmenschen oder an anderen Dingen, die sie übersehen und die ihnen Freude machen; und die Forderung, auch die industrielle Arbeit in diesem Sinn menschlicher zu gestalten – etwa im Sinne der
Experimente zur Ersetzung des Fließbands durch neue Formen der Gruppenarbeit –, ist tausendmal berechtigt. Aber Aussteigen ist kein Weg der Reform. Ständiger Wechsel der Tätigkeit, wie ihn der junge Marx sich für das Endstadium des Kommunismus vorstellte, ist, wenn überhaupt, nur im Überfluß möglich, von dem wir weit entfernt sind – in unserer Gesellschaft ist Arbeit, die auf die zur ökonomischen Rationalität erforderliche Spezialisierung verzichtet, bei noch so
ehrenhaften Motiven und größtem Eifer meist objektiv parasitär: nicht zufällig leben so viele »alternative« Unternehmen vom Bafög oder von den Eltern der Mitglieder. Als parasitär werden sie aber auch, meist ohne Anerkennung der ehrenhaften Motive, von der Masse der Berufstätigen empfunden. Brandt hat in seiner Rede gefragt, warum die alternativ orientierten Jugendlichen der SPD wie den anderen Parteien
davonlaufen, obwohl ihre Ziele, wie er meint, den sozialdemokratischen Zielen nicht widersprechen. Ich glaube, er irrt hier: Die humanen Motive widersprechen nicht denen der Sozialdemokratie – wohl aber die politischen oder vielmehr antipolitischen Ziele. Die Sozialdemokratie ist ein Produkt der industriegesellschaft und ein Vorkämpfer der Demokratie in Staat und Gesellschaft. Sie kann mit denen, die die moderne Welt fur einen weltgeschichtlichen Irrweg halten, keinen
Kompromiß schließen: Sie muß klar sagen, daß die menschenwürdige Versorgung der Milliarden Menschen, die heute die Erde bevölkern, ohne die Industriegesellschaften und ihre berufliche Arbeitsteilung unmöglich und daß alle Alternativen dazu reaktionäre Utopien sind. Sie darf sich auch nicht in der Illusion wiegen, die Bildung von Inseln am Rand der Gesellschaft sei eine Form der Partizipation: Partizipation heißt Teilnahme, Beteiligung an einem größeren Ganzen; Aktivität
von Gruppen, die sich vom Ganzen der Gesellschaft abkapseln, ist keine Partizipation. Die echte Partizipation eines Teiles der »Grünen«, etwa in der Form von ökologischen Bürgerinitiativen als praktische Kommunalpolitik kann in der Tat zu »mehr Demokratie« beitragen. Aber die Abkapselung vieler anderer vom Ganzen führt auch zur Abkapselung von der Demokratie – und oft zur Weigerung, sich ihren Gesetzen zu unterwerfen. Es ist kein Zufall, daß die Gleichgültigkeit gegenüber
Rechtsnormen im alternativen Lager so häufig und keineswegs auf die bösartigen Gewaltanbeter beschränkt ist. Das Recht ist, ebenso wie die Arbeitsteilung, eines der grundlegenden Bindemittel der Gesamtgesellschaft – und wer in seiner Grundhaltung aus dieser aussteigt, wird leicht auch jenes geringschätzen. Die Auseinandersetzung, die heute die Integrationsaufgabe der Sozialdemokratie erschwert, ist also nicht die zwischen
einem zum Teil konservativ gewordenen Stamm von Arbeiterwählern – die ja in der Tat dank der Leistungen sozialdemokratischer Politik heute viel zu konservieren haben – und einer kritischen Jugend, die sich vorwiegend aus den »neuen« Gesellschaftsschichten rekrutiert. Sie ist der Konflikt der Haltungen und Interessen zwischen den »Aussteigern« und der Masse der Berufstätigen aller Art, also der Arbeiter, der Angestellten, der Selbständigen und des Großteils des
öffentlichen Dienstes – mit der teilweisen Ausnahme von Lehrern, die vor ihrer gesellschaftlichen Erziehungsaufgabe resigniert haben, und von Pfarrern, die in der verständlichen Konzentration auf die Rettung gefährdeter Seelen ihre gesellschaftliche Verantwortung hintansetzen. Eine Partei, die für die Probleme und Motive der Aussteiger Verständnis zeigt, kann gewiß hier und da einen Teil von ihnen integrieren, aber nur wenn sie ihrem Weltbild mit klaren Argumenten
entschieden entgegentritt. Eine Partei, die in dieser Auseinandersetzung eine klare Stellungnahme vermeidet, kann nur sich selbst desintegrieren. Ich habe bisher nicht vom Verhältnis der SPD zur Friedensbewegung gesprochen, weil ich glaube, daß es sich dabei um ein wesentlich anderes Problem handelt. Gewiß unterstützt die Masse der Aussteiger, soweit sie sich ein Mindestmaß an politischem Interesse bewahrt haben, die
Friedensbewegung – aber diese geht weit über die Kreise der Aussteiger hinaus (und gewiß nicht nur, weil unter anderen die organisierten Kommunisten darin mitmischen). Die Sorge vor einer Zunahme der nuklearen Bedrohung unseres Landes und der Glaube, man könne dieser Bedrohung durch einseitigen Verzicht auf Stationierung weiterer Kernwaffen auf diesem Territorium entgehen, haben sehr breite Kreise ganz verschiedener sozialer Herkunft und ganz verschiedener
Generationen erfaßt, wenn auch mit besonderem Schwergewicht in den jüngeren Altersgruppen, und mir ist keine soziologische Analyse bekannt, die Anhänger und Gegner des Doppelbeschlusses der NATO säuberlich von einander trennte. Dies ist für mich nicht der Ort, erneut auf die Substanz der Nachrüstungsfrage einzugehen; ich war und bin von der Notwendigkeit sowohl der Vorbereitung der Nachrüstung wie
der beschleunigten Durchführung von Verhandlungen als der besten Kombination von Mitteln überzeugt, um einen mehr oder minder weitgehenden Abbau der auf Westeuropa gerichteten sowjetischen Mittelstreckenraketen und ein neues nicht arithmetisches, aber effektives Ost-West-Gleichgewicht in Europa auf niedrigerem Niveau zu erreichen. Ich stimme darin mit der seinerzeitigen Initiative des Bundeskanzlers und seiner heutigen Politik. ebenso wie mit dem Beschluß des Berliner
SPD-Parteitags vom Dezember 1979, der den wenige Tage später gefaßten NATO-Beschluß vorwegnahm, überein. Was ich hier kurz erörtern will, ist das Verhältnis der Sozialdemokratie zu der so mächtig angewachsenen Friedensbewegung, die sich eindeutig gegen diesen Doppelbeschluß richtet. Zwar will die Masse ihrer Anhänger nicht etwa die sowjetische Nuklearrüstung in Europa rechtfertigen oder beschönigen – das tun nur die
Kommunisten, die sich zwar an der Bewegung beteiligen und sie zu manipulieren suchen, aber von sich aus nie solche Massen auf die Beine hätten bringen können, und einige wenige Mitläufer. Aber die Bewegung als Ganzes begrüßt zwar Verhandlungen, will aber die westliche Nachrüstung unabhäingig von deren Ausgang ausschließen: Sie erkennt die Notwendigkeit der Herstellung eines annähernden Gleichgewichts zur Sicherung von Frieden und Unabhängigkeit
nicht an und schwächt damit objektiv die Chancen des Verhandlungserfolgs. In dieser Situation hat die Sozialdemokratie nach meiner Meinung eine doppelte Aufgabe: Sie darf keinen Zweifel darüber lassen, daß sie an ihrem Berliner Beschluß festhält und die Politik der Bundesregierung stützt. Und sie muß die intensivste mögliche Diskussion mit allen gutwilligen Elementen der Friedensbewegung führen, um sie von der Ehrlichkeit nicht
nur des deutschen, sondern auch des – in den letzten Monaten viel deutlicher gewordenen – amerikanischen Verhandlungswillens, aber auch von der Notwendigkeit der Vorbereitung der Nachrüstung als Verhandlungsargument zu überzeugen. Diese Aufgabe wird dadurch erschwert, daß ein beträchtlicher pazifistischer Flügel in den Reihen der SPD selbst die Nachrüstung grundsätzlich ablehnt und die Revision des Berliner Beschlusses auf dem nächsten Parteitag erstrebt. Für
die Überzeugung der eigenen Reihen wie für die Beeinflussung der Anhänger der Friedensbewegung kommt es daher in erster Linie auf die Haltung der Parteiführung und insbesondere des Vorsitzenden an. In der Presse der deutschen Gegner der Sozialdemokratie und in großen Teilen der Presse des verbündeten und neutralen Auslands wird immer wieder behauptet, Brandt sei »eigentlich« ein Gegner der Nachrüstung und des Berliner
Beschlusses, für den er gestimmt hat. Ich kenne nicht nur keine Äußerung oder Handlung von ihm, die als Beleg dafür dienen könnte; ich stelle fest, daß er – ebenso wie Egon Bahr – noch in letzter Zeit immer wieder betont hat, der Doppelbeschluß sei der einzig mögliche Weg gewesen, um Ost-West-Verhandlungen über ein Gleichgewicht der eurostrategischen Waffen auf niedrigerem Niveau zustande zu bringen, und die Verhandlungen müßten und würden nun auf
dieser Grundlage beginnen. Ich will aber nicht verhehlen, daß Brandt der Verbreitung von Behauptungen über seine angeblich pazifistisch-neutralistische Haltung eine Zeitlang durch geringe innerparteiliche Aktivitäten und besonders durch eine kritische Unterlassung am Vorabend der Bonner Friedensdemonstration vom 10. Oktober erleichtert hat. Ich teile nicht die Meinung einiger sogenannter »Rechter« in der Partei, Brandt hätte die Teilnahme von Sozialdemokraten an
dieser Demonstration unter Berufung auf das bestehende Verbot von gemeinsamen Aktionen mit Kommunisten als statutenwidrig erklären sollen: Ich bin bekanntlich kein Freund der Zusammenarbeit mit Kommunisten, doch bei dieser Demonstration war die Beteiligung von Kommunisten für ihr Zustandekommen ganz unwesentlich, und es lag gewiß nicht im Interesse der Sozialdemokratie, oder im Interesse einer realistischen Meinungsbildung der Öffentlichkeit, gegen
sozialdemokratische Teilnehmer an dieser Demonstration wegen der Teilnahme von Kommunisten disziplinarisch vorzugehen. Aber die Demonstration richtete sich eindeutig nicht nur gegen die Politik der Bundesregierung, sondern auch gegen die beschlossene Politik der SPD; und angesichts der Teilnahmebereitschaft vieler Sozialdemokraten und der prominenten Teilnahme des Parteipräsidiumsmitglieds Erhard Eppler hätte ich es notwendig gefunden, daß der Vorsitzende
oder ein leitendes Organ der SPD im voraus öffentlich klarstellte, daß die Sozialdemokratie bei aller gemeinsamen Friedensliebe die von dieser Demonstration propagierten Vorstellungen über den besten Weg zum Frieden nicht teilt und darum allen Parteimitgliedern von der Beteiligung abrät. Brandt hat das nicht tun wollen – und das hat auf' die Partei nach meinem Eindruck nicht integrierend gewirkt, sondern die innerparteilichen Spannungen verschärft. Ich glaube, die Motive dieser Unterlassung Brandts zu verstehen. Sie beruhen nicht, wie die Gegner behaupten, auf eigenen Zweifeln am NATO-Beschluß und am Berliner SPD-Beschluß, sondern auf der Erkenntnis der Bedeutung der sich entwickelnden Friedensbewegung und der Notwendigkeit für die Sozialdemokratie, die Diskussion mit ihren Anhängern auf breitester Front zu führen: Er mag geglaubt haben, daß ein
öffentliches Abraten von der Teilnahme an der Demonstration die Weiterführung der Diskussion erschwert hätte. Ich bin von diesem Argument, wenn es sein Argument ist, nicht überzeugt: Zur wirksamen Diskussion gehört, daß man beim Partner keinerlei Unklarheit über den eigenen Standpunkt bestehen läßt. Aber das ist nun vorüber, und die öffentliche Diskussion hat an vielen Orten begonnen: In dieser Diskussion lassen die offiziellen Sprecher der Sozialdemokratie, angefangen von
Brandt in seiner letzten Rede, keinen Zweifel über ihren Standpunkt betreffend den Weg zur Sicherung des Friedens. Daß aber diese Diskussion auf breiter Front geführt wird, ist nicht nur für die Sozialdemokratie wichtig, sondern für unsere Demokratie überhaupt. Denn eben weil die Friedensbewegung so viel breiter ist als jene Aussteigerbewegungen, von denen oben die Rede war, gibt es in ihr sehr viel mehr Menschen guten Willens, die in die demokratische Gemeinschaft integriert
bleiben müssen – und können.- Die Auseinandersetzung mit den Anhängern der Friedensbewegung innerhalb und außerhalb der Partei ist eine Aufgabe, die von der Sozialdemokratie im Lebensinteresse unserer Demokratie übernommen werden mußte und übernommen worden ist – mit dem Risiko zeitweiser Verluste, aber mit der Chance eines wesentlichen Beitrags zur Wiederherstellung einer breiten Übereinstimmung über die
notwendige Zusammengehörigkeit von verhandlungsorientierter Friedenspolitik und Verteidigungsbereitschaft. Ich glaube nicht, daß diese Auseinandersetzung auf die Dauer zu einem Auseinanderfallen der Kernelemente führen wird, auf die sich die Sozialdemokratie stützt. Die Auseinandersetzung mit den »grünen« und »alternativen« Jugendlichen muß zwischen konkreten, konstruktiven Beiträgen
zur Verbesserung der Umweltpolitik, zur Humanisierung der Arbeitsbedingungen und zur Korrektur anderer Mängel unserer Gesellschaft einerseits und der Ideologie und Praxis eines Aussteigertums, das der arbeitsteiligen Industriegesellschalt feindlich ist und vom demokratischen Prozeß nichts wissen will, klar unterscheiden. Wenn die Sozialdemokratie die konstruktiven Beiträge ermutigt, aber die Grenze zu den Aussteigern mit unmißverständlicher Schärfe zieht, wird sie
keines der grundlegenden Elemente verlieren, die das nach Godesberg entstandene breite soziale Bündnis getragen haben. Wenn sie diese Grenzziehung versäumt, wird sie ihre Basis nicht nur unter den Facharbeitern, sondern in allen berufstätigen Schichten untergraben. Die Zukunft der Sozialdemokratie hängt von der klaren Herausstellung ihrer Identität als einer Partei der demokratischen und sozialen Fortentwicklung der arbeitsteiligen Industriegesellschaft ab. Richard Löwenthal in der Neuen Gesellschaft Oktober (?) 1981 
|