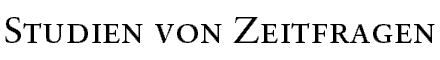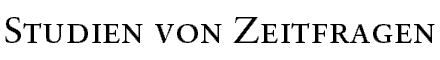Die Herausforderungen der Neuen Ökonomie Von Ulrich Klotz Verwertung immaterieller Werte Einleitende Bemerkungen von DH In der zweiten Auflage seiner Abhandlung “Geistige und
körperliche Arbeit”, die 1972 erschienen ist, schreibt Alfred Sohn-Rethel: “In der Kybernetik verfällt die Funktion der menschlichen Sinnesorgane und operativen Hirntätigkeit selbst der Vergesellschaftung.” Im selben Jahr 1972 konnte man in TIME erstmals einen ausführlichen Bericht über die Jahrhunderterfindung lesen, welche den Weg für das eröffnete, was heutzutage mit vielen Schlagwortmarken benannt wird: den Mikroprozessor. “Neue
Ökonomie” als Übergangszustand einer Revolution aller Funktionen der Vergesellschaftung und vielleicht zuletzt auch eines Paradigmenwechsels in der Bildung der “gesellschaftlichen Synthesis” ist gewiß nicht die schlechteste Begriffsprägung für einen Wandel in der Weltwirtschaft. Ob es am Ende um eine neue Wirtschaftslehre geht, ist dabei nicht die wichtigste Frage. Viel bedeutsamer ist, daß in den Verhältnissen der neuen Ökonomie immaterielle Werte eine wachsende Rolle
spielen. Eine Ökonomie aber, deren wichtigste Produkte leicht kopierbare und weltweit verfügbare Informationen sind, funktioniert nach anderen Regeln als eine Wirtschaft, in der unter Einsatz von Rohstoffen, Kapital und Arbeit materielle Güter hergestellt und gehandelt werden. Somit stellen sich auch viele Fragen zu den Institutionen der kapitalistischen Ökonomie völlig neu: Nichts wird dem Wandel
so sehr ausgesetzt sein wie der Handel in der kapitalistischen Weltwirtschaft und ihren nationalstaatlichen Regionen. Wenn das Produkt der neuen Ökonomie ein “immaterieller Wert” ist, so fragt sich immer noch, ob dieses Erzeugnis (des Geistes), nachdem es seiner Ding-Eigenschaft bereits ledig geworden ist, vielleicht auch seine wesentlich “seins-nähere” Eigenschaft dereinst auch noch abstreifen kann, nämlich Ware zu sein, deren Formwandel im Tausch zur Realisierung von Mehrwert
einer Institution, des Marktes, bedarf: der Markt könnte seine gesellschaftliche Undurchdringlichkeit für das einzelne Bewußtsein (und die “gesellschaftliche Synthesis”) um so mehr verlieren, als die Fortschritte der Informationsverarbeitung und Kommunikation in “Echtzeit” eine bewußt steuernde Beeinflussung der mit diesem Markt verbundenen und in seinen Netzflüssen sich vollziehenden gesellschaftlichen Praxis in Reichweite bringen könnte. Lesen Sie bitte hier den Aufsatz von Ulrich Klotz
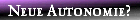
Business Reengineering / Arbeiten in der Informationsgesellschaft Von Wilfried Glißmann Fachtagung der IG Metall am 21. und 22. Juni 1996 in Düsseldorf Es kommt nicht häufig vor, daß sich in den Gewerkschaften aus
den Reihen der Beschäftigten, nicht der fest angestellten oder außerhalb im akademischen Betrieb tätigen Intellektuellen begriffliches Denken und Theoriebildung entwickeln.
So hat es sich aber herausgebildet bei dem Versuch eines Betriebsrates von IBM, die neueste Managementlehre vom »Business reengineering« zu durchschauen und sie einmal nicht ideologiekritisch zu betrachten und zu schmähen, sondern die Prozesse zu betrachten und zu verstehen, die diese neue
Managementtechnik tatsächlich bei den Arbeitenden mit Erfolg bewirkt und die sich zunächst vor allem als ein Gewinn an Autonomie darstellt - sowohl für einzelne Mitarbeiter als auch für Gruppen.
Allem Anschein hat die von Wilfried Glißmann, einem weiteren Betriebsrat (von Bull), dem Philosophen Klaus Peters aus Köln und einem weiteren Philosophen aus Bonn gebildete Arbeitsgruppe, die sich mit der Untersuchung dieser neuen Organisationsweise der Arbeit befaßt, einigen Einfluß in den
Diskussionen der IG Metall erlangt. Die Metallgewerkschaft bemüht sich seit Jahren, die Angestellten vor allem in den Wirtschaftszweigen zu organisieren, in denen Ingenieursarbeit immer mehr von der Informatik geprägt wird.
Die besonderen Anforderungen der Kapitalverwertung in der informationstechnischen Wirtschaft werden einerseits von Software- und Hardwarewissen, aber auch von mit großer Beschleunigung sich verändernden technischen und
Verfahrensneuerungen bestimmt, die allesamt nicht nutzbar wären, wenn es nicht ein ständig sich erneuerndes geistiges Erfinderkapital gäbe, das in den herkömmlichen Formen von Befehl und Gehorsam bzw. Anweisung und Auftragsarbeit nicht mehr optimal in Bewegung gesetzt werden kann.
Entscheidend aber ist, das sie mit der neuen Organisation zwei Einsichten verbinden: - Mit der neuen Organisation, der »unselbständigen
Selbständigkeit«, kann ein Gewinn an Autonomie verbunden sein
- Die herkömmliche Form der Unterstützung der Beschäftigten durch gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung läßt sich (insbesondere bei Angestellten) unter den neuen Bedingungen nicht mehr durchhalten.
Lesen Sie dazu weiter  und ein Gespräche mit Wilfried Glißmann  
|